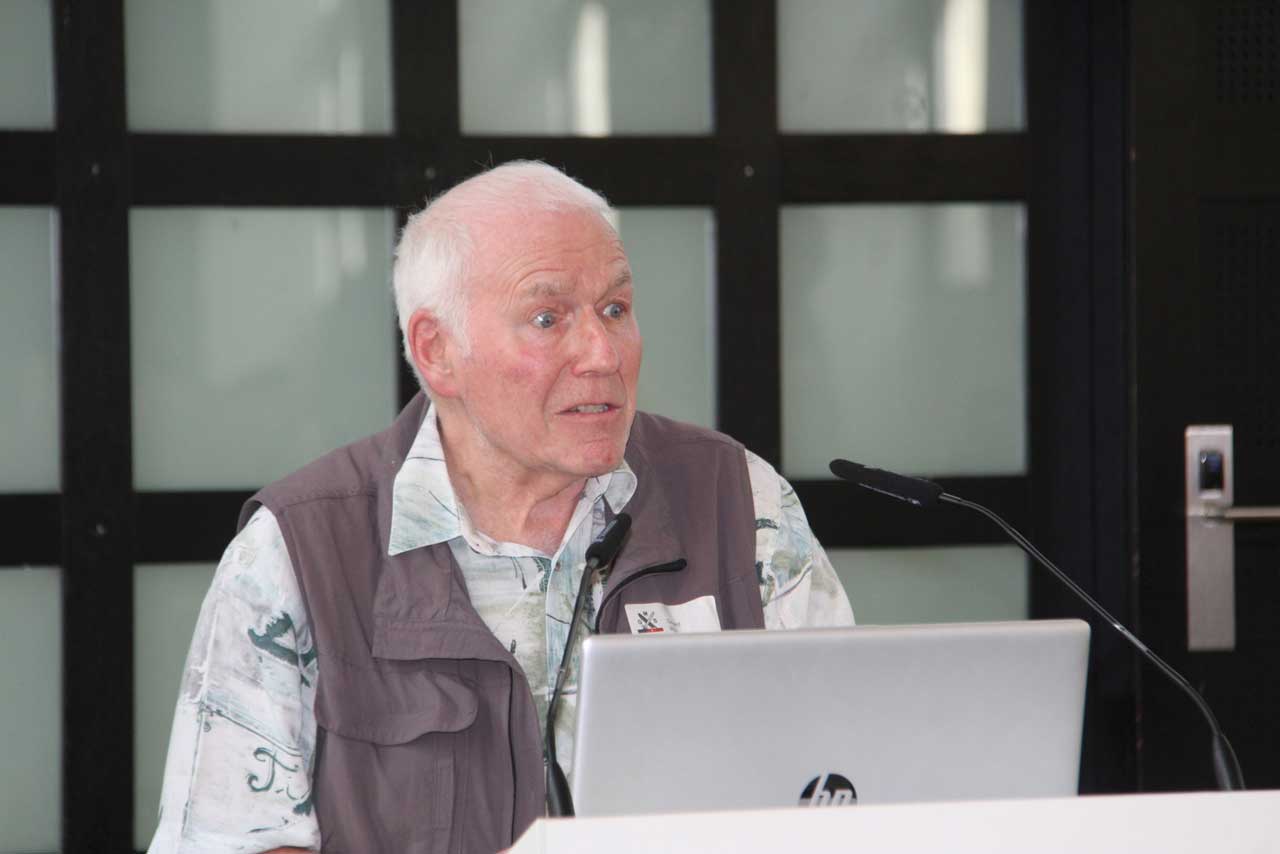General Ulrich Wille; Gestalter und Oberbefehlshaber der Schweizer Armee
Samstag, 22. Februar 2025, Hotel Glockenhof Zürich
Referenten
- Dr. Dieter Kläy, Vorstandsmitglied der GMS, Tagungsleiter
- Prof. Dr. Rudolf Jaun, Prof. em. für Geschichte der Neuzeit und Militärgeschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich.
- Peter Muff, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für Militärgeschichte und Fahrzeugexperte des HAM in Burgdorf.
- Gerhard Wyss, lic. phil hist, Kirchdorf BE
- Dr. Michael Olsansky, Leiter der Dozentur für Militärgeschichte an der Militärakademie der ETH Zürich
Die Zusammenfassung des Tagungsleiters
Zum 100. Todestag von Ulrich Wille
Auch 100 Jahre nach seinem Tod polarisiert die Person von Ulrich Wille, Oberbefehlshaber der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg. Seine Person verdient aber eine differenzierte Beurteilung, so das Fazit der Referenten anlässlich der GMS-Frühjahrstagung vor rund 120 Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vom Artillerie-Instruktor zum Oberbefehlshaber der Schweizer Armee

Rudolf Jaun zeichnete Willes Leben in den prägenden Ereignissen und Etappen nach. Wille war einer der ersten studierten Instruktoren der Schweizer Armee. Er schloss seine Studien mit einem Doktorat in Jurisprudenz ab und begann als Instruktor der Artillerie in Thun. Der Sieg von Deutschland über Frankreich 1871 hat ihn – geboren 1848 in Hamburg – geprägt. Nach seiner Überzeugung haben die Deutschen gewonnen, weil sie Disziplin hatten. Diese Überzeugung übertrug er in seinen Instruktionsdienst. Disziplin ist eine moralische Zucht, die durch das richtige Benehmen der Vorgesetzten vermittelt wird, so Willes Auffassung. Den Schweizer Offizieren warf er vor, sie würden sich nicht durchsetzen. Immer stärker entwickelte er den Anspruch, der führende Offizier der Schweizer Armee zu sein. 1883 wurde er Oberinstruktor der Kavallerie. Gleichzeitig begann er eine intensive publizistische Tätigkeit. 1894 entstanden die Vorschriften für die «Reiterei», das erste moderne Militärreglement der Schweizer Armee. Von 1892 bis 1896 war er Waffenchef der Kavallerie, legte sich aber mit dem Bundesrat an und verliess 1896 den Instruktionsdienst. Vorübergehend arbeitslos, zeitweise Journalist, kandidierte er erfolglos für den Nationalrat und den Zürcher Stadtrat. 1900 wurde er Milizdivisionär und Professor für Militärwissenschaften an der ETH sowie Chefredaktor der Allgemein Schweizerischen Militärzeitschrift ASMZ. Jetzt hatte Wille wieder Deutungsmacht. Er legte den Grundstein zur Militärpädagogik und gründete 1911 die Militärschule für Instruktoren, heute Militärakademien an der ETH. Zürcher Offizierskreise engagierten sich für eine Rückkehr in den Instruktionsdienst.
Kritik an seiner Haltung gab es schon in den 90-er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ab 1900 entwickelte sich der Antimilitarismus. Die Linke sprang auf diesen Zug auf und begann, Wille zunehmend zu kritisieren. Dieser konterte gekonnt, doch die Kritik an seinen Positionen wurde im Ersten Weltkrieg stärker. 1914 war die allererste Generalmobilmachung der Armee. Wille war der Kandidat des Bundesrates für den Oberbefehlshaber. Die Bundesversammlung tendierte zwar auf Generalstabschef Sprecher von Bernegg. Nachdem auf Ersuchen Willes Sprecher seine Kandidatur zurückgezogen hatte, wurde Wille gewählt. 1914 und 1915 lief es gut, 1917/1918 wurde die Lage schwieriger. Robert Grimm attackierte ihn in der Berner Tagwacht und stellte die Forderung, dass Wille «schweizerischer» werden sollte. Wille hat das zugesetzt. Es gab Intrigen bis zum Vorwurf, er sei senil, was nicht der Fall war, da er weiterhin viel und eloquent publizierte. In der Bewältigung des Generalstreiks 1918 führte bereits Sprecher von Bernegg Regie. Wille hatte nicht mehr viel zu sagen.
Die Beschaffung von Maschinengewehren

Der Kavallerieinstruktor Oberst Wille beantragte im Februar 1888 mit grösstem Nachdruck die sofortige Einführung einer Mitrailleuse für die Kavallerie, vorzugsweise das 3 läufige Nordenfeldt Geschütz der britischen Armee.
Peter Muff (Bild oben) untersuchte, ob Wille damit lange vor den Anderen die Bedeutung von Maschinengewehren erfasste.
Bereits seit 1867 wurden immer wieder handbetätige Mitrailleusen geprüft. Mitte 1887 wurde das erste automatische Maschinengewehr vom genialen Erfinder Hiram Maxim selber in Thun vorgeführt. Maxim adaptierte bis 1989 die Waffe auf die revolutionäre neue 7,5mm Patrone von Eduard Rubin, das moderne Maschinengewehr war damit geboren. Vier Maxim MG wurden im Herbst 1891 von der Kavallerie in intensiven Truppenversuchen getestet, der Versuchsleiter Major Wildbolz empfahl die Einführung der Waffe für die Kavallerie. Für Oberst Wille war die Waffe jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschaffungsreif, da insbesondere noch nicht klar sei, «ob durch den Besitz dieser Maschinengewehre der Kavallerie ihr kavalleristischer Geist genommen wird».
Der Antrag des Bundesrates zur Beschaffung wurde dann im November 1893 vom Parlament abgelehnt, man wollte zuerst die neue TO 1894 bzw. die Volksabstimmung zu den neuen Militärartikeln abwarten. Erst Mitte 1898 beschloss das Parlament nach harter Diskussion die Schaffung von vier berittenen Maschinengewehr Kompanien der Kavallerie mit je acht Maxim MG. Beschafft wurden total 69 «Maschinengewehre 00».
Die Einführung von Maxim Maschinengewehren für die Nahverteidigung der Festungen Gotthard und St. Maurice verlief sehr viel problemloser. Bereits ab 1891 wurden total 72 «Maschinengewehre 94» auf ihren charakteristischen Reff Lafetten beschafft.
Peter Muff kommt abschliessend zum Schluss, dass Wille keineswegs lange vor den Anderen die Bedeutung der Maschinengewehre erkannt hatte. Vielmehr hat er mit seinem Antrag mehrheitlich offene Türen eingerannt und mit seiner kompromisslosen Haltung die Beschaffung von Maxim MG für die Kavallerie um Jahre verzögert.
Auf die Erfordernisse des Krieges ausgerichtet
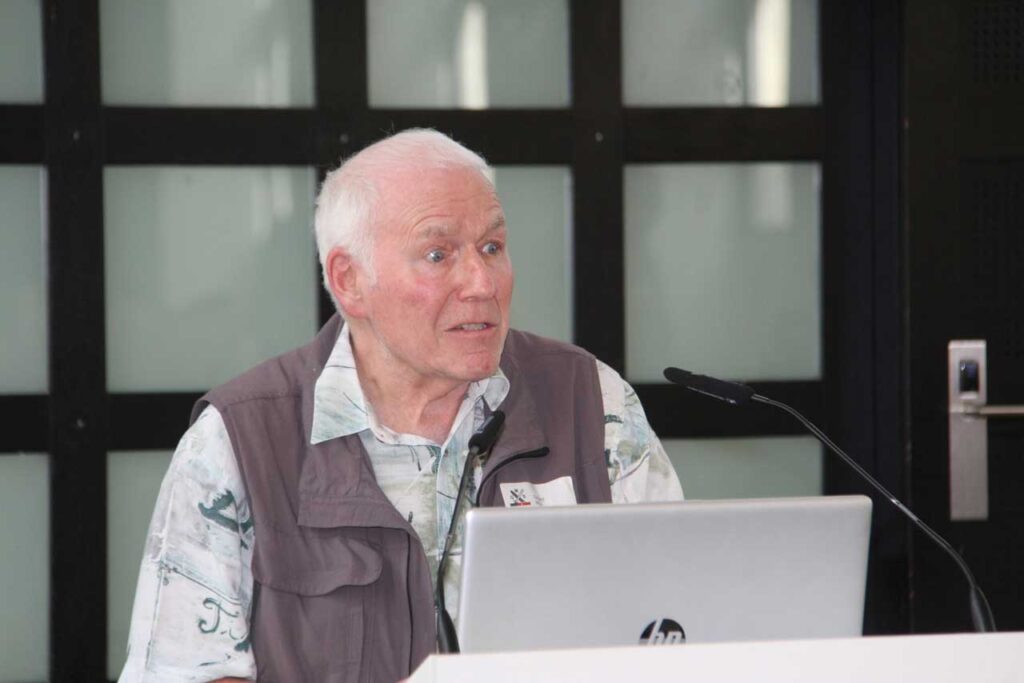
Gerhard Wyss untersuchte die „Vorschriften für den Dienst und die Ausbildung der Schweizerischen Reiterei“ von 1894, wie das Kavallerie-Reglement korrekterweise heisst. Dieses bildet einen Markstein in der schweizerischen Reglements-Geschichte. Willes Vorschriften orientierten sich an den Erfordernissen des Krieges. Erstmal wurde ein Reglement der Schweizer Armee unter militärpädagogischen Gesichtspunkten verfasst. Das Reglement betonte die Gründlichkeit in der Ausbildung, die Priorität der Erziehung zur Zuverlässigkeit und Pflichttreue vor der Vermittlung von Wissen und Können, die Beschreibung der Methode zur Erschaffung der Disziplin und die Schaffung der Voraussetzungen zu selbständigem, initiativem und sicherem Handeln der Vorgesetzten. Im Zentrum stand der Hauptmann in seiner Funktion als Kompaniekommandant.
Die Wille-Schüler

Michael Olsansky widmete seinen Vortrag den Schülern Willes. Verschiedene «Generationen» können unterschieden werden. Die massgeblichen Wille-Schüler rekrutierten sich hauptsächlich aus dem Zürcher Umfeld, aber nicht nur. Ihr gemeinsamer Nenner war, dass nur über den Gehorsam des Soldaten Kriegsgenügen erreicht werden kann. Wille-Schüler plädierten für das Primat des Militärs für alle Bürger. In Fragen der Kampfführung waren sie für den Bewegungskampf. Vor dem Ersten Weltkrieg waren Ferdinand Affolter, Professor für Militärwissenschaften an der ETH, Major Eduard Wildbolz und der spätere Korpskommandant Hermann Steinbuch weniger Schüler als eher Mitstreiter Willes. Im Ersten Weltkrieg bestand die erste Generation aus Fritz Gertsch, der später politisch nicht mehr zu halten war, und aus dem Dienst entlassen wurde. Emil Sonderegger zeichnete sich durch eine realistische Vorstellung der Kriegführung aus. Der Appenzeller war während des Landesstreiks Kommandant der Ordnungstruppen in der Stadt Zürich. Als späterer Generalstabschef vertrug er sich schlecht mit Bundesrat Scheurer und trat 1923 wegen Differenzen in der Armeeentwicklung zurück. Er wurde Militärschriftsteller und forderte eine antiliberale Verfassungsrevision.
Die Generation Anfang der 20er Jahre gruppierte sich um den Sohn Willes, Ulrich Wille oder «UW2» genannt. Ihm schwebte eine soldatisch erzogene Schweiz vor. In der Zwischenkriegszeit etablierte er sich als Kommandant der Zentralschulen, eine Position, die er während acht Jahren ausübte. Während dieser Zeit konnte er alle Kommandanten der Infanterietruppen prägen. Wille Junior hatte später Verbindungen zu deutschnationalen Politikern und zur nationalsozialistischen Spitze, vor allem zu Rudolf Hess. General Guisan entfernte ihn 1942 aus der Armee.
Die Schüler der 3. und 4. Generation waren Gustav Däniker, Georg Züblin und Fritz Rieter. Ihr Einfluss schwand aber zunehmend im militärischen Alltag. Gustav Däniker endete tragisch. Ein hochintelligenter Berufsoffizier, er wurde aber in der Folge einer Denkschrift 1941 aus dem Generalstab entlassen und schied 1942 ganz aus dem Bundesdienst aus. 1947 erschoss er sich. Hans Frick war Willeaner durch und durch, unterschrieb aber im Gegensatz zu Däniker die «Eingabe der Zweihundert an den Bundesrat» nicht. Wille Schüler der letzten Generation war der Ausbildungschef der 80-er Jahre, Korpskommandant Roger Mabillard. Sie alle hatten Gemeinsamkeiten, unterschieden sich aber auch.
Stefan Gubler’s Bilder der Frühjahrstagung
Aktualisiert am 17/01/2026